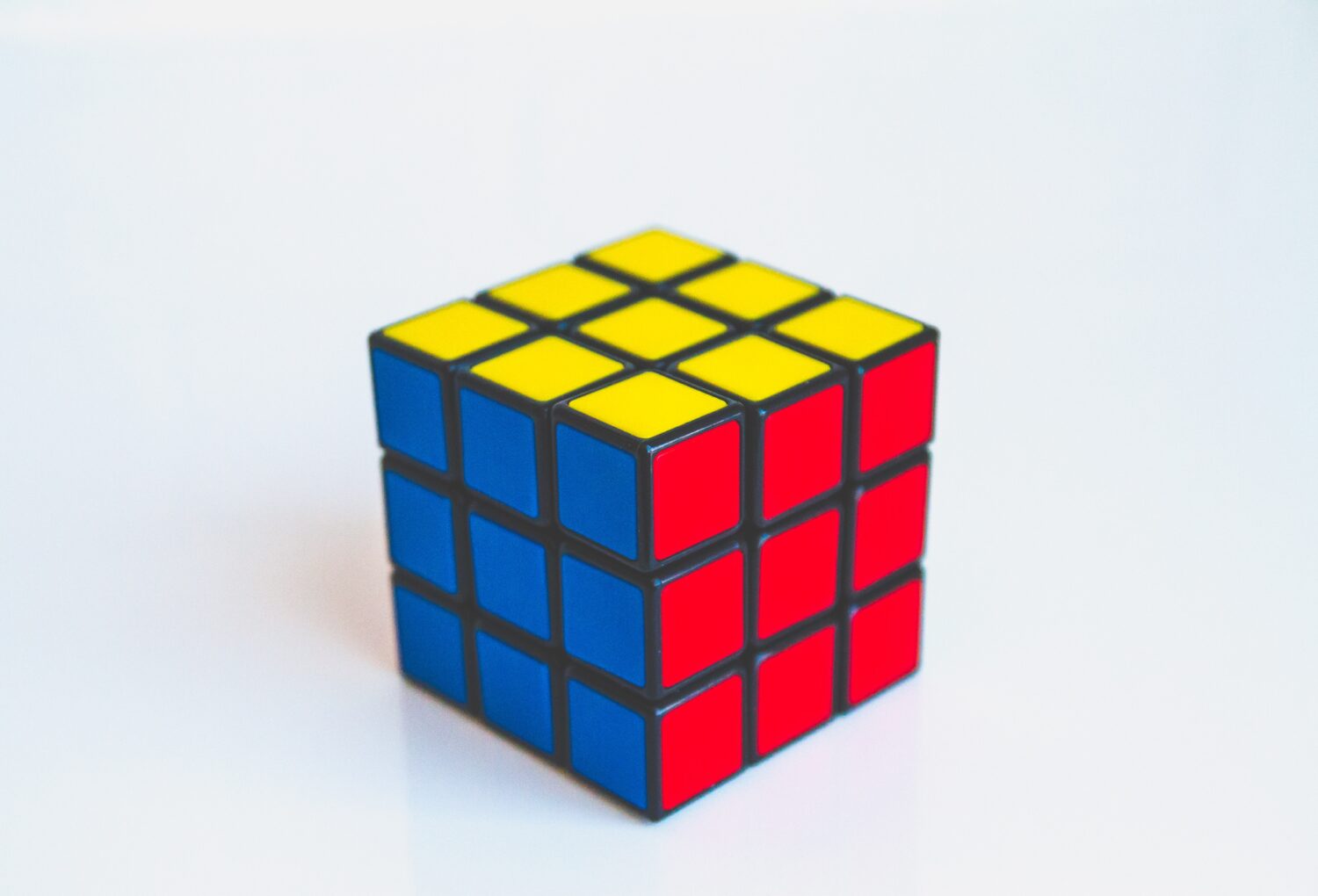
Beitrag vom: 22. Januar 2024
Umsatzverluste in Milliardenhöhe durch nachgemachte Waren
Europäische Hersteller von Bekleidung, Kosmetik und Spielwaren erleiden durch nachgemachte Waren jährlich Umsatzverluste in Höhe von rund 16 Milliarden Euro. Zudem gingen durch solche Betrügereien rund 200.000 Arbeitsplätze verloren, wie aus einer Studie der EU-Agentur für geistiges Eigentum (EUIPO) im südspanischen Alicante hervorgeht.
In Deutschland gingen demnach allein 40.000 Arbeitsplätze verloren. „Nachgeahmte Waren verursachen reale Kosten – für Verbraucher, für Marken und für unsere Volkswirtschaften. Diese jüngste Studie zeigt die sehr realen Kosten in Bezug auf die Umsatz- und Arbeitsplatzverluste in der EU auf“, schrieb der Exekutivdirektor der EUIPO, João Negrão.
Der Studie zufolge ist die deutsche Spielwarenindustrie mit einem Drittel der jährlichen Umsatzeinbußen (334 Millionen Euro) durch gefälschte Waren in der EU einer der am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige. Bei Bekleidung sei Zypern am stärksten von Fälschungen betroffen, bei Kosmetika Frankreich. In absoluten Zahlen seien die Auswirkungen in der Bekleidungsindustrie auf europäischer Ebene am negativsten. Sie verliere jährlich fast 12 Milliarden Euro an Einnahmen, was 5,2 Prozent des gesamten Umsatzes ausmache.
Auch der europäische Kosmetiksektor und die Spielwarenindustrie wiesen aufgrund gefälschter Markenprodukte deutlich geringere Umsätze auf: Die Verluste beliefen sich auf drei Milliarden Euro bei Kosmetika (4,8 Prozent des Umsatzes) und eine Milliarde Euro bei Spielwaren (8,7 Prozent des Umsatzes). Im Bereich Arbeit hat die Produktfälschung ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen. Dem Bekleidungssektor gehen der EUIPO-Studie zufolge, die sich auf Daten aus den Jahren 2018 bis 2021 stützt, 160.000 Arbeitsplätze verloren, im Kosmetikbereich sind es 32.000 und im Spielwarensektor 3600 weniger Beschäftigte.
Zugleich stellten gefälschte Markenartikel oft auch schwerwiegende Gesundheits- und Sicherheitsprobleme für die Verbraucher dar. Dies gelte vor allem für nachgemachte Kosmetika und Spielwaren. Nach Angaben von EUIPO entfielen 15 Prozent der 2022 an den EU-Außengrenzen beschlagnahmten Waren auf potenziell gefährliche, weil gefälschte Produkte.
Toy Industries of Europe (TIE) fordert die politischen Entscheidungsträger auf, den Digital Services Act (DSA) zügig umzusetzen, damit Marken zu vertrauenswürdigen Hinweisgebern werden können, die illegale Produkte melden können, und die Verantwortung von Online-Marktplätzen bei der Überarbeitung der TSR zu berücksichtigen. Der DVSI schreibt in seinem Positionspapier zum Vorschlag der neuen Spielzeugverordnung:
Der DVSI wünscht sich vor allem eine stärkere und effizientere Marktüberwachung, damit Hersteller von Qualitätsspielwaren nicht durch das Treiben von „schwarzen Schafen“ auf Online-Plattformen unter einem unfairen Wettbewerb leiden. Die Grundsätze der Marktüberwachung und die Pflichten für die Wirtschaftsakteure müssen online und offline identisch sein.

